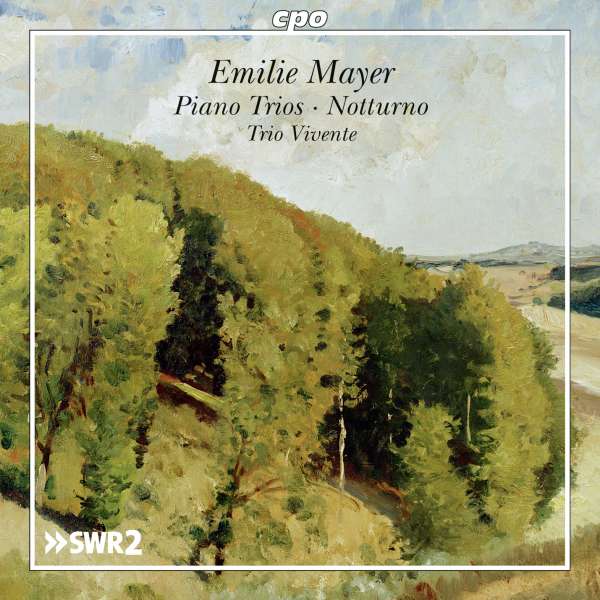
Emilie Mayer (1812-1883) konnte sich über einen Mangel an Anerkennung nicht beklagen. Seit ihrem Berliner Debüt als Komponistin im Jahre 1850 waren ihr die Kritiker wohlgesonnen; ihre symphonischen und kammermusikalischen Werke fanden großen Anklang; um ihr tägliches Leben mußte sie sich nicht sorgen – und doch hält es die Autorin des Einführungtextes für angebracht, die alte Leier anzustimmen, wonach es auch dieser (unvermählt gebliebenen) Dame trotz ihrer ungeheuren Produktivität zeitlebens nicht möglich [gewesen sei], von ihren Kompositionen zu leben“. Die Frage, wer das – außer vielleicht Gioacchino Rossini, Richard Strauss und einigen geschäftstüchtigen Artgenossen – überhaupt je geschafft hätte, wird vorsichtshalber gar nicht erst gestellt ...
Anstatt jedoch auf die verschiedenen Widersprüchlichkeiten des Textes einzugehen – mal heißt es, Frau Mayer habe drei, dann wieder nur zwei Klaviertrios veröffentlicht –, widme ich mich den hier versammelten Stücken, die schon beim ersten Hören einen eigenartig originellen Eindruck hinterlassen haben. Eigenartig, weil hinter der Maske traditioneller Formgebungen und vieler Vertrautheiten eine ausgeprägte Persönlichkeit steckt; und originell, weil Emilie Mayer zwar ihren Beethoven, ihren Schubert, ihren Mendelssohn und ihren Schumann gekannt, ihre Kenntnisse aber mit bisweilen geradezu experimentellen Absonderlichkeiten durchsetzt hat: Da gibt es wunderliche Stimmführungen und pianistische Kapriolen, die plötzlich wie aufgezogene Uhrfedern abschnurren; verzwicktes thematisches Spielwerk (im Finale des Opus 13 etwa) und entzückende, neckische pizzikato-Tupfer (insbesondere im Kopfsatz des Opus 16); dann wieder werden schlichte Gesten, wie sie in Beethovens Sonatinen vorkommen, zu eindrucksvollen Texturen verdichtet, und markant akzentuierte Scherzo-Elemente kräftig umhergewirbelt. Mal rumpelt Frau Mayer herzhaft los, mal gibt sie sich unverhohlenen Sentimentalitäten hin, denen das Trio Vivente indessen, so scheint es mir, mit einiger Zurückhaltung begegnet – was vermutlich geschieht, um die Reputation der Urheberin nicht zu schädigen, dem sinnlichen Erscheinungsbild dieser Episoden aber nicht wirklich zuträglich ist. Man hätte sich in solchen Momenten das Notturno op. 48 als Richtschnur nehmen sollen, das Jutta Ernst am Klavier und Anne Katharina Schreiber auf der Geige mit vielem Geschmack und wohltuender Empfindsamkeit ausgekostet haben, ohne dass dieser (vermutlich letzten) Kreation der selbstbewußt und daher erfolgreich gewesenen Komponistin dadurch der geringste Schaden entstanden wäre.
